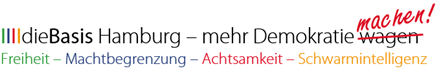Wie die SPD mit Brosius-Gersdorf die Legitimität des Bundesverfassungsgerichts riskiert
Ein Kommentar von Heinrich Wolerts
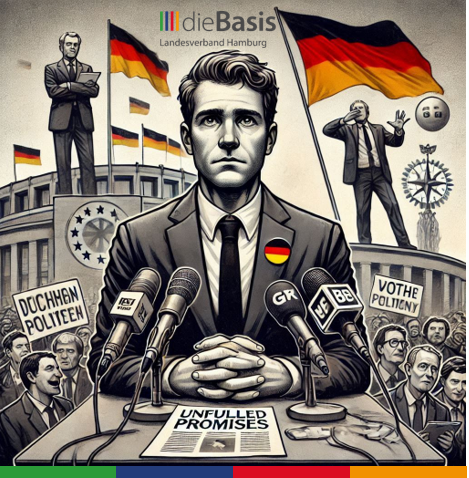
I. Das Problem ist nicht kompliziert
Man muss kein Plagiatsprüfer sein, um zu erkennen, was hier vorliegt.
Man braucht keine forensische Software, kein juristisches Gutachten und keinen Appell an akademische Graubereiche. Es reicht, zwei Texte nebeneinanderzulegen: die Dissertation von Maria Wersig-Brosius-Gersdorf und die Habilitation ihres Ehemannes Christoph Gersdorf.
Beide wurden an der Universität Hamburg eingereicht. Beide behandeln öffentlich-rechtliche Fragestellungen. Beide arbeiten auf zahlreichen Seiten mit identischen Formulierungen, identischen Zitaten, identischer Argumentationsstruktur – oft im selben Wortlaut, ohne Hinweis auf gegenseitige Bezugnahme.
Das hat der Plagiatsforscher Stefan Weber dokumentiert, und zwar mit einer Präzision, die jeden Zweifel ausschließt.
Beispiel gefällig?
„Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Vorbehalt des Gesetzes das Ziel, Grundrechtseingriffe vorhersehbar und kontrollierbar zu machen.“ – exakt derselbe Satz, in beiden Werken, ohne Zitat, ohne Querverweis.
Das ist kein Zufall. Das ist auch kein Fußnotenirrtum. Das ist strukturelle, systematische Textdopplung – über Dutzende von Seiten hinweg.
II. Täterin oder Mitwisserin – beides reicht aus
Nun mag man sich streiten, wer bei wem abgeschrieben hat. War es Gersdorf, der sich bei seiner Frau bedient hat? Oder war es Brosius-Gersdorf, die den Boden für eine spätere Habil ihrer Familie gelegt hat?
Die Antwort ist zweitrangig. Denn in beiden Fällen ist die Schlussfolgerung dieselbe:
Entweder war Brosius-Gersdorf die aktive Quelle der doppelten Verwertung, oder sie war Mitwisserin eines wissenschaftlich unzulässigen Vorgangs. Beides ist unvereinbar mit der Ehre, am Bundesverfassungsgericht zu urteilen.
III. Und was tut die SPD?
Sie schweigt. Oder tut so, als sei nichts.
Die SPD hat Brosius-Gersdorf offiziell für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen – nachdem die Vorwürfe öffentlich geworden sind. Die Parteiführung weiß Bescheid. Die Ministerpräsidenten wissen Bescheid.
Und dennoch wird das Verfahren durchgezogen, als handle es sich um eine Formalie – nicht um eine Frage von Verfassungslegitimität und wissenschaftlicher Integrität.
Es ist ein gefährlicher Akt des politischen Selbstbetrugs. Denn die Öffentlichkeit sieht es.
Und sie wird sich merken:
Wer heute für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen wird, darf morgen abgeschrieben haben – solange es dem politischen Kalkül dient.
IV. Warum das gefährlicher ist, als es klingt
Deutschland steht nicht vor einer Verfassungskrise. Aber es steht vor einer Glaubwürdigkeitskrise.
In einer Zeit, in der das Vertrauen in Institutionen schwindet, in der Recht und Macht nicht mehr klar auseinandergehalten werden, kann man sich keine Richterin leisten, die unter dem Verdacht steht, das zentrale Prinzip von Wissenschaft verletzt zu haben:
Das Gebot der Eigenständigkeit.
Das Bundesverfassungsgericht ist nicht nur ein juristisches Organ, sondern ein symbolisches Rückgrat des Rechtsstaats. Es urteilt über Parteienfinanzierung, Notstandsgesetze, Kompetenzen zwischen Bund und Ländern.
Und immer wieder: über das Verhältnis von Bürger und Staat.
Wenn eine Richterin dort mit einem Schatten aus ihrer akademischen Vergangenheit einzieht, den niemand transparent aufgearbeitet hat, dann steht nicht nur sie im Zwielicht. Dann steht das ganze Gericht unter Beobachtung.
V. Die Universität Hamburg steht im Zentrum
Man kann dieses Problem nicht von Hamburg trennen. Die Universität Hamburg war der Ort, an dem diese Arbeiten eingereicht wurden. Dort wurde die Dopplung übersehen – oder bewusst ignoriert.
Dort sitzen heute die Verantwortlichen, die nichts tun – obwohl die Vorwürfe auf dem Tisch liegen.
Was an der Universität Hamburg übersehen wurde, wird morgen im Bundesverfassungsgericht vielleicht verurteilt – oder legalisiert. Beides ist gleichermaßen bedrohlich.
VI. Die SPD riskiert, was sie zu schützen vorgibt
Die SPD sagt gerne, sie stehe für Rechtsstaat, Chancengleichheit, Bildungsethik. Doch in diesem Fall ignoriert sie nicht nur die Realität – sie verweigert sich der Wahrheit.
Wer so handelt, riskiert nicht nur seinen Ruf, sondern auch das Vertrauen der Bürger in die Institutionen, die diesen Staat zusammenhalten. Denn an diesem Fall entscheidet sich eine Grundfrage der Republik:
Gilt wissenschaftliche Integrität auch dann, wenn es politisch unbequem wird?
VII. Fazit
An Hamburgs Uni hängt die Zukunft unseres Staates. Nicht weil sie allein verantwortlich wäre, sondern weil sie der Ort ist, an dem dieser Skandal entstanden ist – und vertuscht wurde.
Und an der Frage, wie wir damit umgehen, entscheidet sich, ob dieses Land bereit ist, seine Institutionen zu verteidigen – oder zu opfern.