Plenarsitzung am 24. September 2025

dieBasis hat die zweite Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft nach der Sommerpause beobachtet. Wir schauen auf das parlamentarische Geschehen aus der Sicht mündiger und kritischer Bürgerinnen und Bürger – und berichten über Vorlagen und Abläufe, die besonders bemerkenswert oder diskussionswürdig erscheinen.
Was auffiel
Der Aufruf der einzelnen Redner erfolgt immer mit dem Satz: „Für die Fraktion der … spricht Herr/Frau …“. Diese Wendung entlarvt die tatsächliche Stellung unserer Abgeordneten. Nach Artikel 7 der Hamburgischen Verfassung sind Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden.
Offensichtlich vertreten die Redner nicht immer ihre eigene Auffassung, sondern die zuvor durch die jeweilige Fraktion festgelegte Linie. Wie können Abgeordnete bei einem offensichtlich bestehenden „Fraktionszwang“ ihrem Gewissen in jedem Fall folgen? Es stellt sich auch die Frage, ob die Redner im Auftrag der Fraktion handeln.
Die Erbschaftsteuer-Debatte in Hamburg angekommen
Das erste Thema der Aktuellen Stunde war: „Leistung muss sich endlich lohnen: Schlupflöcher bei Erbschaftsteuer schließen, Spitzenvermögen konsequent besteuern“.
Schon die beiden Teile des Themas scheinen konträr, und beide Teile gehören dem Grunde nach nicht zusammen. Im Übrigen war die Diskussion erwartungsgemäß hitzig und kontrovers.
Die konsequente Besteuerung von Spitzenvermögen in Deutschland erfordert aufgrund nachfolgender Fakten durchaus eine politische Diskussion:
- In Deutschland besitzt die reichste Gruppe von rund 10 % der Haushalte zusammen etwa 54 % des gesamten Privatvermögens (2023). Die untere Hälfte der Bevölkerung hält insgesamt nur rund 3 % – also sehr wenig im Vergleich zur Spitze.
- Nach Forbes 2025 hat Deutschland weltweit die viertmeisten Milliardäre (ca. 171), hinter den USA, China und Indien. Das ist ein Hinweis auf eine hohe Dichte sehr großer Vermögen. Zugleich bescheinigt die Bundesbank Deutschland im Euroraum eine vergleichsweise hohe Vermögensungleichheit.
- Wissenschaftliche Langzeitdaten zeigen: Der Anteil der unteren 50 % der Bevölkerung am Gesamtvermögen hat sich seit den 1890er-Jahren etwa halbiert (von über 5 % auf rund 2,8 % bis 2018), während die Abstände zur Spitze deutlich gewachsen sind. Das Vermögen konzentriert sich in Deutschland zunehmend oben.
Quellen:
- Publikationen der Bundesbank, Monatsbericht – April 2025
- Forbes: The Countries With The Most Billionaires 2025
- Wealth and its Distribution in Germany, 1895–2018
Dies allerdings nur in Bezug auf die Erbschaftsteuer zu diskutieren, beleuchtet lediglich einen Aspekt des Themas. Auch andere Steuern wie die Vermögensteuer müssen in die Betrachtung einbezogen werden. Außerdem gehören Überlegungen dazu, wie ein Vermögensaufbau bei der weitgehend vermögensarmen Mehrheit der Bevölkerung gefördert werden kann.
Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, weshalb sich die Hamburgische Bürgerschaft in ihrer Aktuellen Stunde in diesem Umfang mit dem Thema beschäftigt. Zwar steht das Steueraufkommen aus der Erbschaftsteuer – wie auch aus der Vermögensteuer – nach Art. 106 Abs. 2 GG den Bundesländern zu. Die Gesetzgebungshoheit liegt alerdings beim Bund (Art. 105 Abs. 2 i. V. m. Art. 72 Abs. 2 GG). Die Gesetzgebung bei den Landessteuern erfordert die Zustimmung des Bundesrats (Art. 105 Abs. 3 GG).
Das zeigt, dass Debatten zu Änderungen bei der Erbschaftsteuer und der (derzeit ausgesetzten) Vermögensteuer inhaltlich im Bundestag und Bundesrat zu führen sind.
Im Übrigen zeigten die Redebeiträge, dass ideologische Meinungen vorherrschten und fachliches Wissen bei den meisten Abgeordneten nicht vorhanden zu sein schien. Einige Redebeiträge ließen wichtige Teilaspekte weg oder waren einfach falsch:
- Es wurde behauptet, dass es bei der Erbschaftsteuer keine Progression gebe. Ein Blick in § 19 Abs. 1 ErbStG belehrt einen sofort eines Besseren. Erbschaftsteuersätze reichen bis zu 50 % des ererbten Vermögens.
- Behauptet wurde, dass es in den USA bei der Erbschaftsteuer einen Freibetrag von 14 Mio. US-$ pro Person gebe. Diese Aussage ist in mehrerlei Hinsicht unzutreffend. In den USA wird nicht der Erbe, sondern der ganze Nachlass als Einheit besteuert. Aus diesem Grund heißt die Steuer dort auch Nachlasssteuer (Estate Tax). Der Freibetrag betrifft den ganzen Nachlass. Gibt es also zehn Erben oder Vermächtnisnehmer, entfällt nur ein Zehntel des Freibetrags auf jeden Begünstigten. Persönliche Freibeträge für Familienangehörige gibt es – anders als in Deutschland – nicht. Werden in Deutschland Vermögen an den Ehegatten, an Kinder und Enkel vererbt, können die Freibeträge zusammen schnell mehrere Millionen Euro betragen. Außerdem erheben neben dem Bund auch viele US-Bundesstaaten Nachlass- bzw. Erbanfallsteuern. Die Freibeträge in den US-Bundesstaaten sind regelmäßig niedriger. Daneben können auch Gemeinden eine Nachlasssteuer erheben.
- Es wurde behauptet, Schweden habe die Erbschaftsteuer abgeschafft. Das ist richtig, verschweigt aber, dass Erbschaften – so auch in Kanada – als „fiktive“ Veräußerungsgewinne der Einkommensteuer unterliegen. Für in Deutschland ansässige Erben mit Vermögen in Schweden oder Kanada führt das zu einer nicht zu vermeidenden Doppelbesteuerung.
- Es wurde behauptet, dass Vermieter nichts leisten würden; die Kosten trage der Mieter. Verschwiegen wird, dass Vermieter natürlich ein wirtschaftliches Risiko tragen (z. B. Leerstand). Gleichzeitig wurde verschwiegen, dass wesentliche wirtschaftliche Hinderungsgründe für Wohnungsneubau oder -sanierung explodierende Baustoffpreise und eine überall zu beobachtende Knappheit an verfügbaren Handwerksbetrieben sind.
- Besonders peinlich war, dass viele Redner von „großen Einkommen“ sprachen. Der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen sollte doch jedem Parlamentarier geläufig sein.
Einige Aspekte wurden überhaupt nicht beleuchtet:
- Die leidvolle Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass entsprechende „Steuerreformen“ häufig dazu geführt haben, dass mittlere Einkommens- und Vermögensschichten sowie der Mittelstand stärker belastet wurden, während hohe Einkommen und Vermögen sich einer überbordenden Steuerlast regelmäßig entziehen konnten. Die Diskussion müsste sich um die Frage drehen, wie man die legalen Maßnahmen zur Steuervermeidung sehr reicher Menschen und Familien beschränken könnte. Die Erfahrung zeigt, dass dies bisher keiner Regierung gelungen ist.
- Es wurde auf eine Forsa-Umfrage (Erbschaftssteuer: Sogar Wähler der Union wollen Reiche zur Kasse bitten | STERN.de) verwiesen, nach der 57 % der deutschen Bevölkerung für eine Erhöhung der Erbschaftsteuer seien. Die Aussage ist insoweit ungenau, als sich die Mehrheit nur für die Erhöhung sehr großer Vermögen ausspricht. Hier stellt sich die Frage, weshalb nicht auf Bundesebene ein Referendum abgehalten wird, in dem sich die Mehrheit der Bevölkerung für eine entsprechende Maßnahme ausspricht. Das gäbe Regierung und Parlament die Legitimation und würde ihnen auch die Verpflichtung auferlegen, den Volkswillen umzusetzen.
- Einige wesentliche Aspekte werden bei allen politischen Steuerdiskussionen vernachlässigt. Dies sind der Zwangscharakter einer Steuer sowie die Zweckbindung und die Befristung von Zusatzsteuern oder Steuererhöhungen. Es gibt diverse Untersuchungen auf nationaler und internationaler Ebene, dass Wohlhabende und selbst Milliardäre Zusatzsteuern und Steuererhöhungen befürworten, wenn die Zusatzabgaben zweckgebunden eingesetzt werden.
Eine Quelle: The Influence of Tax Labeling and Tax Earmarking on the Willingness to Contribute — A Conjoint Analysis
Ein Blick in die USA zeigt, wie man öffentliche Projekte mit Zustimmung der Mehrheit finanzieren kann:
- Kalifornien – Proposition 30 (2012): temporäre Zuschläge auf Spitzeneinkommen für einen Zeitraum von sieben Jahren und ein Sales-Tax-Zuschlag für vier Jahre zur Schulfinanzierung.
- Seattle (Washington) – Housing Levy (2023): Erneuerung bzw. Anhebung einer auf sieben Jahre befristeten, zweckgebundenen Grundsteuer (2024–2031) zur Finanzierung von neuem Sozialwohnungsbau, Mietenhilfe und Services.
Dies sind nur zwei exemplarische Beispiele von vielen. Verbunden werden diese regelmäßig mit Volksabstimmungen.
Die Debatte in der Hamburgischen Bürgerschaft zeigte, dass dieses Thema eher von ideologischen Meinungen als von Sachverstand oder Lösungskompetenz beherrscht wird. Außerdem scheint es in den Köpfen der Abgeordneten Blockaden zu geben, die sie daran hindern, über alternative oder neue Lösungsmöglichkeiten nachzudenken.
Weitere Entmachtung der Bezirke in Hamburg?
Der Titel des Tagesordnungspunkts 18 scheint eher langweilig und lässt nicht auf politische Sprengkraft schließen:
„Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes und des Entschädigungsleistungsgesetzes – Senatsantrag –“.
Auslöser der Debatte war die im Senatsentwurf vorgesehene Neuregelung des § 34 BezVG. Wenn eine Bezirksversammlung neun Monate nach Ablauf der Amtszeit keine neue Bezirksamtsleitung gewählt hat, soll der Senat diese selbst ernennen dürfen. Diese eingesetzte Leitung hat die gleiche Rechtsstellung wie eine zuvor gewählte Leitung; die Bezirksversammlung würde dazu nur noch angehört. Das führte zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Die Regierungskoalition begründete dies mit der Sicherung der „Handlungsfähigkeit der Bezirksämter“ und der Vermeidung langer Vakanzen. Kernargumente der Opposition waren eine „Machtverschiebung nach oben“ und die Aushöhlung der Rechte der Bezirksversammlungen sowie der kommunalen Selbstverwaltung.
Am Rande fiel auch der Begriff „Evokation“. Dieser Begriff hat erhebliche politische Sprengkraft. Evokation ist das Recht des Senats, „bezirkliche“ Angelegenheiten wegen ihrer gesamtstädtischen Bedeutung an sich zu ziehen und selbst zu erledigen bzw. zu entscheiden. Rechtsgrundlagen sind § 42 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) sowie § 1 Abs. 4 Verwaltungsbehördengesetz (VerwBehG). Es handelt sich um ein hierarchisches Eingriffs- und Steuerungsrecht der Landesregierung in der Einheitsgemeinde Hamburg.
Jüngste Beispiele sind Oberbillwerder (B-Plan-Verfahren) und Diekmoor (Wohnungsbauvorhaben).
Das Hamburgische Verfassungsgericht (HVerfG) hat in mehreren Entscheidungen die Struktur Hamburgs als Einheitsgemeinde betont und Initiativen, die eine rechtliche Verbindlichkeit bezirklicher Bürgerentscheide gegenüber Senat und Behörden herstellen wollten, zurückgewiesen – so zuletzt im Urteil vom 4. Februar 2022 (HVerfG 6/20). Das Volksbegehren „Bürgerbegehren und Bürgerentscheide jetzt verbindlich machen – Mehr Demokratie vor Ort“ wurde für unzulässig erklärt.
Man fragt sich, wozu Bürgerentscheide gut sein sollen, wenn sie jederzeit vom Senat missachtet werden können.
Insgesamt sind Bezirksamtsleiter mit deutlich weniger Machtbefugnissen als Bürgermeister ausgestattet. Dabei spielt die Einwohnerzahl keine Rolle. Wandsbek ist der bevölkerungsreichste Hamburger Bezirk mit rund 430.000 Einwohnern und damit bevölkerungsreicher als Bochum (rund 360.000). Der Bochumer Oberbürgermeister ist politischer Chef und oberster Verwaltungsleiter der Stadt mit Ratsvorsitz und Organisationsgewalt. Der Bezirksamtsleiter Wandsbek ist Behördenleiter eines Hamburger Bezirks, führt aus und setzt um, führt aber weder ein Parlament noch hat er eigenständige Richtlinien- oder Organisationsmacht. Man fragt sich, welchen politischen Sinn Bezirkswahlen in Hamburg haben.
Wehrhaftigkeit
Und wieder stand die Bundeswehr auf der Tagesordnung. Einer von zwei Tagesordnungspunkten lautete:
„Auch Hamburg braucht eine formelle Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr zur systematischen Einbindung von Jugendoffizieren.“
Es sollen jetzt also vermehrt junge Bundeswehroffiziere in Schulen und Universitäten eingeladen werden. Friedensorganisationen sollen allerdings nicht eingeladen werden. Es ist schon auffällig, wie oft sich die Bürgerschaft in jüngster Zeit mit militärisch-politischen Fragen beschäftigt.
Hamburger werden sich an diesem Wochenende davon überzeugen können, wie es im Ernstfall aussehen wird. Die Militärübung Red Strom Bravo wird Interessierten einen direkten Eindruck vermitteln, was im Bündnisfall Realität werden soll.
Inhalte zur Debatte findet man in der Aufzeichnung der Plenarsitzung in der Mediathek.
Neue Staatsoper in Hamburg
Die Debatte stand unter dem Motto: „Haushaltsplan 2025/2026 – Bau eines neuen Opernhauses auf dem Baakenhöft. Unentgeltliche Überlassung eines Grundstücks …“ (weiter: Dienstbarkeit; Sicherung des Spielbetriebs Dammtorstraße bis zum Umzug).
Hamburg und die Kühne-Stiftung haben vereinbart, auf dem Baakenhöft ein neues Opernhaus zu errichten. Die Stiftung baut und finanziert das Haus und überträgt es nach Fertigstellung der Stadt; die Stadt stellt das Grundstück bereit und trägt klar definierte Standort-Mehrkosten. Am 24.09.2025 stand die Sache im Plenum – politisch heiß diskutiert, sachlich mit bemerkenswert klaren Eckpunkten.
Die Kühne-Stiftung finanziert den kompletten Neubau über eine Projektgesellschaft; nach Fertigstellung geht das Gebäude an die Stadt über. Der Finanzanteil der Stadt Hamburg ist auf 147,5 Mio. € für standortspezifische Mehrkosten (z. B. Gründung, Flutschutz) gedeckelt. Zusätzlich – wie in der HafenCity üblich – werden rund 104 Mio. € aus dem Sondervermögen „Stadt und Hafen“ für öffentliche Flächen und Erschließung bereitgestellt.
Das Regierungslager betonte den Kultur- und Stadtentwicklungsimpuls; Kritiker sahen vor allem Kostentransparenz, Governance der Projektgesellschaft und Risikobegrenzung als Prüfsteine. Das sind berechtigte Fragen, wenn man Hamburger Großprojekte der Vergangenheit betrachtet.
Für den Standort Baakenhöft wurden als Pluspunkte die Wasserlage, Erreichbarkeit und das Stadtbild genannt. Technische Herausforderungen seien der Untergrund und der Sturmflutschutz.
Weitere Hinweise zur Hamburgischen Bürgerschaft
Die übrigen Themen der Sitzung können dem offiziellen Protokoll entnommen werden:
Protokolle der Bürgerschaftssitzungen – Hamburgische Bürgerschaft
Wie die Bürgerschaft arbeitet: Die Hamburgische Bürgerschaft bei der Arbeit beobachten
Die nächste Plenarsitzung findet am 8. Oktober 2025 statt.
dieBasis wird erneut vor Ort berichten.
Bleiben Sie informiert – besuchen Sie unsere Website für weitere Analysen zur Hamburger Landespolitik.
Autor: Peter Scheller
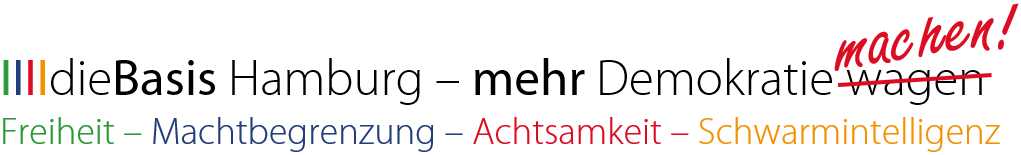

„Der Aufruf der einzelnen Redner erfolgt immer mit dem Satz: „Für die Fraktion der … spricht Herr/Frau …“. Diese Wendung entlarvt die tatsächliche Stellung unserer Abgeordneten. Nach Artikel 7 der Hamburgischen Verfassung sind Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden.“
Das ist ja nicht nur in Hamburg so, meines Wissens existiert diese Formulierung auch im Bundestag und mit Sicherheit auch in anderen Landesparlamenten.
Es wäre mal sinnvoll den Ursprung dieser Formulierung zu eruieren. Ist sie beiläufig entstanden? Oder steckt in dieser Formulierung der konkrete Apell für die Abgeordneten sich dem Willen und dem allgemeinen Konsens ihrer Fraktion zu unterwerfen? Hier wird Artikel 7 der Hamburgischen Verfassung zitiert, aber auf Bundesebene und in allen anderen Bundesländern ist es genauso.
Also ob nun beiläufig oder gewollt: diese Formulierung ist nicht nur verfassungswidrig, sie ist einer Demokratie unwürdig!
Es wäre zu klären inwieweit diese Formulierung mündlich über,iefert fortgetragen oder gar Teil einer schriftlich niedergelegten Anweisung/Handlungsvorschrift ist, die ein zu erfüllendes Protokoll vorgibt.
Eine rein eröffnende Formulierung: „Es spricht (nun) Herr/Frau … der Fraktion… .“ sei daher anzustreben.